Klaas Huizing: Der inszenierte Mensch - Eine Medien-Anthropologie
von tk anno 2005
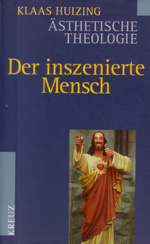
Medienästhetik als eine Aufbauwissenschaft innerhalb der Systematischen Theologie?! Der Würzburger Systematiker Klaas HUIZING betritt im zweiten Band seiner auf drei Bände konzipierten ästhetischen Theologie freilich kein unerforschtes Gebiet, allerdings war es populärwissenschaftlichen Theologen bisher eher ein Anliegen, die historische Bibelkritik im Lichte ihrer wissenschaftlich-theologischen Erkenntnisse auszubreiten und dabei evangelikal geprägten Christen gehörig auf die Füße zu treten. Man denke nur an den Wirbel, den der Göttinger Neutestamentler G. LÜDEMANN anno 1993/94 mit seinen höchst fragwürdigen Thesen zur Auferstehung Christi und paulinischen Christologie ausgelöst hat. HUIZING dürfte mit seinem vorliegenden Werk bisher weit weniger Staub aufgewirbelt haben, selbst wenn sein Thema vorwiegend auf humanistisch geprägte Erkenntnisse aufbaut und frommen Theologen an manchen Stellen Stirnrunzeln bereiten wird. Doch im Kern geht es HUIZING nur sekundär um den theologischen Ertrag seiner Forschungsergebnisse. Vielmehr versucht er im Lichte der postmodernen Film-, Medien- und Musikkultur den Hang zum Religiösen und die Sehnsucht nach Geheiligtem fernab von Katholizität, Papst- und Marienkult herauszuarbeiten. Das gelingt ihm auch mit Bravour, wenngleich seine überaus ästhetisch geformten Satzkonstruktionen oftmals in sprachverliebtem Kuddelmuddel hängen bleiben und somit insbesondere für Leser mit etwas langsamerer Auffassungsgabe eine nicht leicht zu nehmende Hürde bedeuten.
HUIZING gliedert sein Werk in zwei große Abschnitte:
I. Theologie als Medienanthropologie und
II. Topographie medialer Heiligenlegenden.
Interessanterweise führt er im ersten Teil die neue stressfrei erfahrbare Nähe von Ästhetik und Religion u.a. auf den Pionier der Hermeneutik W. SCHLEIERMACHER zurück, was zunächst verwundert, sich im Laufe seiner Betrachtung zur Entwicklung der Medienkultur aber immer mehr zu einem einsichtigen wie logisch nachvollziehbaren Gedankenstrang wandelt.
Zu folgender vorläufigen Definition von ästhetischer Theologie hat sich HUIZING durchringen können: "Christliche Religion artikuliert sich im Kontext der audiovisuellen Medien als religiös-ästhetische Erfahrung. Durch spezifische Gesten werden dabei leibkörperlich gespürte Atmosphären inszeniert, in denen die christlich-religiöse Wahrnehmungskultur und Lebensdeutung wieder erkannt und eigens als Motivation aufgenommen und im Lebensvollzug dargestellt wird." (S. 35).
Somit wird zumindest aus biblisch-theologischer Sicht ein Widerspruch in HUIZINGs Denkansatz erkennbar: Die Vermischung christologischer Theologie und Religion als eine individuelle wie pluralistische Lebensphilosophie unter vielen. Freilich dürfen aber nur unter dieser Prämisse seine nachfolgenden Ausführungen betrachtet werden.
Als besonders hilfreich stellt sich sein Einschub zur Medienkunde und Phänomenologie der Gesten dar. HUIZING greift in diesem Abschnitt immer wieder auf recht anschauliche Art und Weise auf Beispiele aus der modernen Medienontologie zurück, so z.B. auf McLUHANS "Global Village" (Zugang zur Welt wird immer medial vermittelt) oder auf die Dramaturgie des Ausdrucksverstehens am Beispiel von B. BECKER (ja genau, unser sprachgewandtes Tennis-Idol) anhand einer pseudo-wissenschaftlich aufbereiteten BILD-Zeitungsgrafik.
Im zweiten großen Abschnitt widmet sich der Autor ausführlich Legenden der Filmgeschichte (lebenden und nicht mehr lebenden) sowie der modernen Popkultur, um daraus eine Typologie heiliger Medienlegenden zu entwickeln. Dabei entlarvt er auch den Blockbuster-Riesen "Forrest Gump" als eine erschreckende Melange aus Kunst, Kommerz und Religion, um sein Resümee schlussendlich mit zwei biblischen Zitaten aus Matthäus 5,5 und Psalm 127,2 zu verdichten. Gewagt und mutig, aber legitim.
Besonders seine Betrachtung zu MADONNAs Video "Like A Prayer" (selbige bezeichnet der Autor als "Mutter aller Video-Legenden") verdient Respekt. Jede Videosequenz wird nach Gestik, Mimik und Choreographie schonungslos als ein Versuch entlarvt, den bilderfreundlichen Ikonoklasmus durch sexuelle und selbst erhöhte Provokation zu zerstören.
Selbst P. STEELE, seines Zeichens Frontman der Düstermetaller TYPE 'O NEGATIVE, bekommt sein Fett weg. Dessen Videoclip "Christian Woman", welcher um einiges rabiater und zügelloser nicht nur das Christentum als Religion, sondern auch den leidenden Christus zwielichtig-provokant darzustellen versucht, deckt HUIZING als plumpes Manöver auf, Religion als unglaubwürdig und deshalb mit blasphemisch gebärdendem Einspruch darzustellen.
Summa summarum bleibt fest zu halten, dass "Der inszenierte Mensch" auf der Grundlage postmoderner medienwissenschaftlicher Untersuchungen aufbauend eher für den wachen Medienpädagogen von heute eine interessante Lektüre bietet. Aber auch medienwissenschaftlich interessierte Theologen sollten mal reinschnuppern.
Klaas Huizing: Der inszenierte Mensch - Eine Medien-Anthropologie. Stuttgart: Kreuz Verlag 2002. 288 Seiten, Hardcover. ISBN 3-7831-2145-0. EUR 26,90.