Wolfgang Kabus (Hrsg.): Vom Psalter zum Pop
von *tf anno 2008
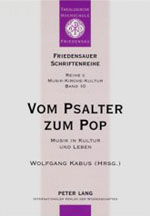
Dieser Band ist die Dokumentation der Ringvorlesung "Musik liegt in der Luft - Was Kultur mit uns macht", die an der Theologischen Hochschule Friedensau vom 17. Januar bis 21. März 2005 unter der Leitung von Miriam Heibel stattfand. Das Inhaltsverzeichnis und die Autorenschaft lassen eine spannende Lektüre darüber vermuten, wie Musik, Kultur und Alltag miteinander verknüpft sind, welche Wechselwirkungen von Religion und Musik sich beschreiben lassen und wie musikwissenschaftliche, theologische und musikpädagogische Ansätze darauf reagieren.
Den Auftakt bildet der u.a. auch am Leipziger Institut für Musikwissenschaft tätig gewesene Theologe und Musikwissenschaftler Hans Seidel, unbestritten eine Institution hinsichtlich der biblischen Deutung musikalischer Tatsachen im Kontext der Zeit ihrer Entstehung. In seinem Artikel "Vom Tempel zur Synagoge - Heilige Musik im Wandel der Zeiten" vermag er es, überzeugende Deutungen damaliger Musizierpraxis abzuliefern, die sicherlich für Neugierige eine profunde Grundlage anschließender Diskussionen zum Gebrauch von Musik im kirchlichen Kontext sein können. Zwar ist seine Untersuchung dezidiert auf den historischen Rahmen der Entstehung von Tempelmusik bezogen, Ableitungen für die Praxis der Gegenwart lassen sich davon allerdings relativ mühelos bewerkstelligen. Der Theologe Harald Schroeter-Wittke geht in seinem Beitrag "Unerhörte Erhörungen - Präludien zu einer musikalischen Religionspädagogik" beispielhaft auf drei Musikstücke des romantischen und darauf aufbauenden neuromantischen Bereichs sowie ein weiteres Beispiel von Viktor Ullmann ein, um die theologische Dimension des Musikalischen zu illustrieren. Die Lesbarkeit dieses Beitrags wird leider durch umfangreiche Fußnotenangaben erschwert. Zur theologischen Sichtweise des Autors lässt sich etwas verkürzt sagen: Wer suchet, der findet. Nicht alle seine Interpretationen würde ich so unterschreiben wollen. Auch der Ausblick dessen, was Schroeter-Wittke als Entwurf einer musikalischen Religionspädagogik darstellt, überzeugt mich nicht wirklich. Zu wenig dran am Puls der Zeit, zu sehr auf das Gebiet der Kunst bezogen, wie ich meine. Der folgende Artikel aus der Feder des Berliner Pop-Professors Peter Wicke zum Thema "Soundtracks - Von der Macht der Musik in digitalen Medienwelten" umfasst leider nur ganze 7 Seiten. Das ist schade, vor allem deshalb, weil seine These, dass die Digitalisierung unmittelbaren Einfluss auch auf die Gestalt von Musik selbst hat, haben kann, verdiente eine genauere und provokantere Auseinandersetzung. Denn hier - an der Gestalt von Musik im digitalen Revier - sind Ansätze fruchtbarer interdisziplinärer Untersuchungen nicht nur möglich, sondern auch nötig. Der folgende Beitrag von Stefanie Rhein unter der Überschrift "'Was wir mit Kultur machen' - Selbstsozialisation mit Musik und Medien am Beispiel der Teenie-Fankultur" stellt eine empirische Studie über Fantypen vor. Leider liegt das Entstehungsdatum dieser Studie schon einige Jahre zurück, im Jahr 2000 wurde sie bereits veröffentlicht. Das bringt unweigerliche Minuspunkte hinsichtlich der Aktualität und damit der Kompatibilität zu gegenwärtigen Entwicklungen und Tendenzen, wie sie beispielsweise Wicke im vorgeordneten Beitrag beschreibt. Interessant ist die Studie dennoch zu lesen, da sie dem Leser eigene Deutungen ermöglicht. Der folgende Artikel aus der Feder des im musikwissenschaftlichen Sektors promovierten Pianisten, Komponisten und Arrangeurs Paul Riggenbach unter dem Thema "Funktionen von Musik im Wandel - Jenseits von Wille und Bewusstsein" stellt verschiedene Zugänge zur Deutung der Funktionen von Musik dar. Dass im Zentrum der musikalischen Analyse allerdings der Schlager "Griechischer Wein" steht, irritiert den Rezensenten doch beträchtlich. Auch die Unterstreichung des Warencharakters nicht nur populärer Musik als deren wahrer Charakter kann aus meiner Sicht so nicht stehen bleiben. Dies ist ein Rückschritt hinter den mittlerweile auf dem Gebiet der Funktionsbestimmung von Musik erreichten Stand. Der Friedensauer Professor für Vergleichende Erziehungswissenschaft Horst Friedrich Rolly schreibt in seinem Beitrag über die "Phänomenologie der akustischen Wahrnehmung". Die damit einhergehende Ausweitung des Untersuchungsgebietes weit über den Musikbereich hinaus stellt zweifellos eine wohltuende Erweiterung der Untersuchungsperspektive des Bandes dar. Mit 9 Seiten ist auch dieser Beitrag äußerst knapp bemessen, zu knapp angesichts des damit eröffneten Betrachtungsfeldes, wie ich meine. Somit sind auch hier nur grobe Linien in der Auseinandersetzung mit dem Thema erkennbar. Als zusammenfassender Einblick in das über Musik hinaus akustisch Relevante ist der Beitrag allerdings gut brauchbar. Die Praxis kommt beim folgenden Artikel ins Blickfeld. Elke Josties von der Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin beschreibt unter der Überschrift "'Kultur öffnet Welten' - Das Streetbeat-Jugendmusikprojekt beim Karneval der Kulturen in Berlin" einen praxisnahen Ansatz, wie man mit Musik die Zielgruppe vor allem der Jugendlichen erreicht und was Musikpraxis für diese im Vollzug bedeuten kann. Einen ähnlich praxisverorteten Ansatz vermutet man auch beim folgenden Beitrag, den Petra Jürgens verfasst hat. Ihr Thema lautet "Musik und Gesundheit - Das Medium als Mittel zum Zweck für Therapie, Krisenintervention und Prävention" und stellt einen musiktherapeutischen Einblick dar, der an Funktionen von Musik anschließt und diese nun auf praktische Anwendbarkeit hin prüft. Wichtige Eckpunkte ihres Ansatzes sind das sinnliche Potential von Musik und der durch sie eröffnete Spielraum für den Menschen. Dass der Schwerpunkt dabei auf dem heilenden Potenzial von Musik liegt, überrascht nicht, blendet aber kritische Ansätze dazu völlig aus. Hier hätte es zumindest eines Hinweises darauf bedurft, dass solch abweichenden Deutungen vorhanden sind. Die Gesangspädagogin und Musikpädagogin Gottlobe Gebauer schreibt kurz vor Schluss des Büchleins über "Musik- und Lebensbiographie - Beobachtung eines Wechselspiels". Der essayistisch gestaltete Beitrag orientiert sich an drei Musikbeispielen der Komponisten Ravel, Prokofjew und Bach. Es ist ein Vortrag von Pädagogen für Pädagogen, hoch im Ziel und mit als gegeben vorausgesetzten Vorannahmen über die Zielgruppe der zu Pädagogisierenden. Dass Biografie und Musik in einem engen Zusammenhang stehen, bildet die Kernaussage des Beitrages. Nicht überraschend, nicht neu, aber engagiert vorgetragen. Die Formel für die Errechnung von Erkenntnis, die sich am Schluss des Artikels findet, ist originell und provoziert durch ihre Aussage zum weiteren Nachdenken. Sie hätte am Beginn des Beitrages stehen sollen, um ihr Potential auszureizen. Last but not least schreibt der an der TH Friedensau magistrierte Mutram Peters über eine selbst durchgeführte empirische Untersuchung unter dem Motto "Canto ergo sum - Aktives Musizieren und die Entwicklung der persönlichen Identität". Etwas schwierig ist der Umstand, dass es hier eben nicht um canto, sondern um das Musizieren geht. Auch die aus den Leitfadeninterviews seiner Untersuchung gezogenen Schlüsse überzeugen mich nicht immer. Hier wäre das Risiko eigener Theoriebildung angemessener gewesen, die von Peters aufgestellten Thesen ersetzen dies leider nicht. Auch das Neue, das möglicherweise Unerwartete fehlt mir in diesem Aufsatz, der das Komprimat seiner Magisterarbeit darstellt.
Fazit: Ein durchaus lesenswertes Büchlein, welches allerdings wenig Psalter und noch weniger Pop enthält. Auch fehlt die im Titel aufgezeigte musikhistorische Komponente völlig. Sollte dies nicht beabsichtigt gewesen sein, wäre man sicherlich mit einem anderen Titel besser bedient gewesen. Das wirklich Neue ist in diesem Band unterrepräsentiert, was dem Rezensenten ein "Schade!" entfahren lässt. Als Dokumentation der Aktivitäten der Theologischen Hochschule Friedensau gut geeignet, sich mit anderen Institutionen zu vergleichen, ist für den nicht involvierten Leser die Ausbeute an Denkanstößen als zu gering einzuschätzen.
Wolfgang Kabus (Hrsg.): Vom Psalter zum Pop. Musik in Kultur und Leben, Friedensauer Schriftenreihe, Reihe C Musik-Kultur-Kirche, Band 10. Frankfurt/Main et al: Peter Lang 2007. 151 Seiten, ISBN 978-3-631-57536-9, 34,00 Euro